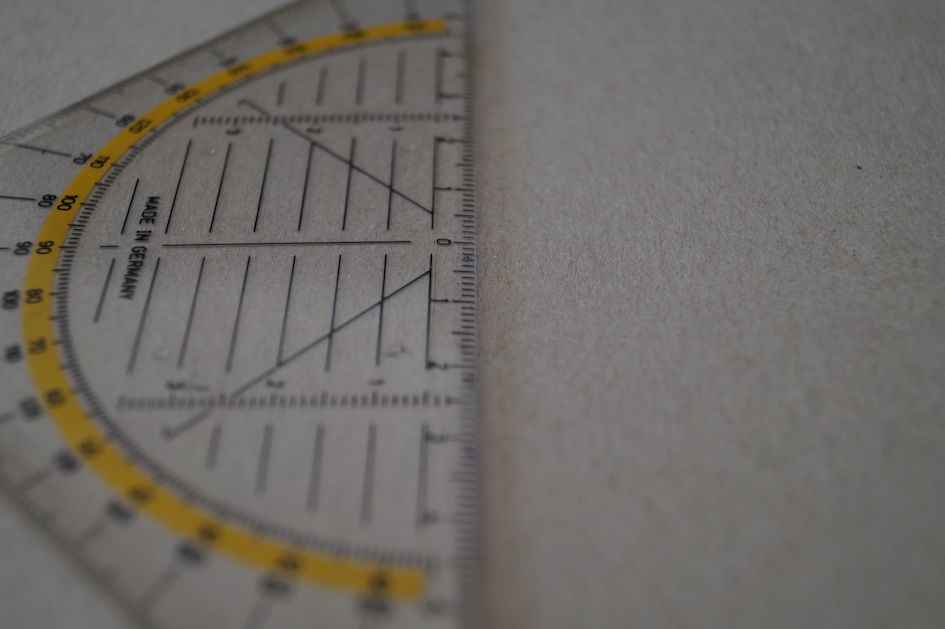Die Sache mit dem „WIR-Gefühl“
Jedes Team ist eine Ansammlung von einzigartigen „Ichs“ und gute Teamperformance lebt von den Stärken der einzelnen Teammitglieder. Gleichzeitig ist in einem erfolgreichen Team das „Wir“ größer als das „Ich“.
Folgt daraus automatisch das viel beschworene „Wir-Gefühl“? Dass das nicht der Fall ist, macht schon das ähnlich gelagerte Wort „Teamgeist“ deutlich. Er ist nur schwer zu fassen, zu beschreiben und nichts Konstantes. Kurz: ein Geist eben, der sich auch schnell verflüchtigen kann.
Grob zusammengefasst, zeichnet sich ein „Wir-Gefühl“ dadurch aus, dass ein großer Zusammenhalt untereinander herrscht und die Beteiligten sowohl Identifikation als auch ein Zusammengehörigkeits- und Bindungsgefühl erleben.
Es ist nicht möglich, ein „Wir-Gefühl“ zu erzwingen, und schon gar nicht, „von oben“ zu befehlen. Doch es gibt viele Möglichkeiten, es zu stärken. Dazu zählen Faktoren wie:
- Teamkultur besonders hinsichtlich Kommunikations-, Feedback-, Konflikt- und Fehlerkultur
- Führungsqualität
- Wertschätzung, Lob und Respekt
- Möglichkeiten der Mitgestaltung (Ideenbörsen, „Spaghetti-Prinzip“ etc.)
- Erlebnisse, die gemeinsame Erinnerungen schaffen, wie Fahrradtouren, Mannschaftssportarten, Hochseilgarten, Musizieren (Chor, Band, Orchester etc.), Kochkurse, Restaurantbesuch, Public Viewing bei Sportveranstaltungen
- Identitätsstiftende, lieb gewordene Rituale pflegen
- Feiern entsprechender Anlässe (Jubiläen, bestandene Prüfungen etc.)
- Humor
- „Kleinigkeiten“ wie aufmunternde Post it‘s am Spind, ehrliche Dankeschöns, mitgebrachte Süßigkeiten oder Handgriffe, die ohne große Worte für eine andere Person übernommen werden.
- Zusammenarbeit verschiedener Generationen bewusst fördern –> siehe auch https://passgenau-schaefer.de/publikation/
- …
Das „Wir-Gefühl“ und die dazugehörige Teamstimmung ist alles andere als nur „Nice to have“. Im Gegenteil: Es ist ein entscheidender Faktor dafür, ob gute Arbeit geleistet wird oder eben nicht. Denn je stärker die emotionalen Bindungen sind, desto motivierter, produktiver und zufriedener mit ihrer Arbeit sind die Beteiligten.1 Und das hat wiederum einen positiven Einfluss auf Leistung, Motivation, Kommunikation, Fehlerkultur, Konfliktmanagement, Fluktuation, Krankheitstage, Wissenstransfer, Einarbeitungsqualität und Image. Das freut nicht nur das Management, weil die „Zahlen stimmen“, sondern auch die Mitarbeitenden und die „Kunden“. Und wer begeistert ist, erzählt das gern weiter. „Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund!“, sagt dazu die Bibel.